Marie Moskou
Zwischennutzung eines Platzes in Brüssel

Während der vierjährigen Zwischennutzung konnten Ideen für Nutzungsmöglichkeiten für den Platz Marie Janson entwickelt und direkt vor Ort erprobt werden. © Marie Moskou
Verortung
Place Marie Janson im Stadtteil Saint-Gilles in Brüssel/Belgien
Zeitraum
2016–2019
Größe
10 000 m2
Akteur*innen
Toestand (Projektleitung), Nachbarschaft, Künstler*innen, Lokale Organisationen
Eigentumsverhältnisse
Gemeinde Saint-Gilles
Rechtliche Rahmenbedingungen
Top-down Stadterneuerungsprozess
Finanzierung
Das Projekt wurde von der Gemeinde Saint-Gilles und der Region Brüssel-Hauptstadt im Rahmen des „Contrats de Quartiers durables“ (nachhaltiger Nachbarschaftsvertrag) für das Zielgebiet Parvis-Morichar 2016-2020 unterstützt.
Abstract
Das Projekt Marie Moskou entwickelte Zukunftsperspektiven für den Platz Marie Janson im Zentrum von St. Gilles (Brüssel). Der Platz – auch bekannt unter dem Namen „Carrè Moscou“ – liegt in einem dicht besiedelten Stadtteil mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen. Er hat einen schlechten Ruf als sozialer Brennpunkt und Drogenumschlagplatz. Daher wurde das Areal von der Brüsseler Stadtverwaltung im Rahmen der Contrats de Quartier durables (einem Programm zur Revitalisierung und Stadterneuerung) als Zielgebiet definiert. Die gemeinnützige Organisation Toestand wurde von der Gemeinde St. Gilles mit der Aktivierung des Platzes beauftragt. Sie sollten den Platz in einer Zwischennutzung bespielen, bis konkrete Baupläne für die Umgestaltung vorliegen. Für das Team von Toestand, dessen Expertise in der Transformation von leerstehenden Gebäuden in temporäre soziokulturelle Zentren liegt, war Marie Moskou damit das erste Projekt im öffentlichen Raum. In einem Zeitraum von vier Jahren lud das Projektteam mit regelmäßigen Formaten Menschen aus der Nachbarschaft ein, über die Zukunft des Platzes nachzudenken. Durch materielle und immaterielle Interventionen wurde der Platz schnell zu einem beliebten Treffpunkt. Das Projekt verfolgte das übergeordnete Ziel, die Nachbarschaft näher zusammenzubringen und die Menschen für ihre Wohnumgebung – insbesondere den Platz – zu sensibilisieren. Die wichtigsten Erkenntnisse der vierjährigen Analyse wurden in einem Bericht veröffentlicht, der sich neben Fachexpert*innen auch an die Stadtbewohner*innen selbst richtete. Der Bericht umfasste zentrale Elemente (z.B. Begrünung, Freizeit- und Sportanlagen, Sitzmöglichkeiten und öffentliche Toilettenanlagen), die der Ausschreibung für die bevorstehende Umgestaltung zur Berücksichtigung beigelegt wurden. In einem Auswahlverfahren wurde mittlerweile ein Konzept des Studio Paola Vigano in Zusammenarbeit mit den Designern von VVV sowie zwei weiteren Design-Büros ausgewählt, das die Ergebnisse aus dem Zwischennutzungsprojekt Marie Moskou aufgreift. Ende 2020 sollte der Umbau beginnen.



Hunderte von Pflanzentrögen sorgten für eine temporäre Begrünung des Platzes. © Marie Moskou
Alle Veranstaltungen waren kostenlos und möglichst niedrigschwellig. © Marie Moskou
Bei den regelmäßigen Aktivitäten am Platz gehörten Kinder und Jugendliche zu den Hauptzielgruppen. © Marie Moskou
Charakteristika


Ziel der vierjährigen Zwischennutzung war es, den Platz Marie Janson durch Veranstaltungen und räumliche Interventionen zu aktivieren und zentrale Elemente für den endgültigen Umgestaltungsentwurf zu definieren, wie z.B. die Begrünung des Platzes, die Diversifizierung der Nutzer*innen, die Schaffung von Sitzmöglichkeiten im Zentrum.
Für das Projekt war eine kontinuierliche Präsenz vor Ort ausschlaggebend. Die Frequenz an Aktivitäten nahm mit Projektlaufzeit zu. Entstandene Sitzmöglichkeiten oder ein Pavillon blieben auch nach den Aktivitäten am Platz.


Um das geringe Budget zu kompensieren, verfolgte das Projekt die Philosophie, auf vorhandene Ressourcen zurückzugreifen. Bestehende Netzwerke wurden für die Bespielung des Platzes aktiviert. Andernorts ausgediente Materialien wurden für das Design am Platz wiederverwendet, wodurch es von manchen als „amateurhaft und billig gemacht“ kritisiert wurde. Dem Projektteam war es gelungen, die Nutzer*innen vor Ort so in das Projektgeschehen zu involvieren, dass sie von sich aus den Veränderungsprozess am Platz vorantrieben.
Ständige Improvisation und das Dehnen von Vorschriften waren ein wesentlicher Teil des Projekts. Obwohl zum Beispiel ein Lager, Wasser- und Stromanschluss von Anfang an vom Projektteam gefordert wurden, dauerte es über ein Jahr bis die Stadtverwaltung diese bereitstellte. Manchmal fanden spontane Aktivitäten, die für das Projektziel entscheidend waren, statt, ohne vorab auf eine Genehmigung zu warten.
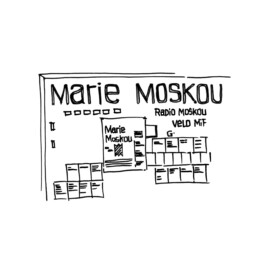

Die Beziehung zwischen Projektteam und Stadtverwaltung war während des gesamten Zeitraums angespannt. Zum Beispiel beschloss die Stadtverwaltung mitten in der Projektlaufzeit und ohne Mitsprache des Projektteams, an fünf Tagen in der Woche einen Marktplatz im Zentrum des Platzes zu errichten. Dadurch war der zentrale Bereich des Platzes nicht mehr für temporäre Interventionen verfügbar. Das Projekt musste auf die Randzone ausweichen. Insgesamt erzielte das Projekt jedoch eine ausgezeichnete Reputation in Brüssel. Auch andere Stadtviertel suchten den Kontakt zu Toestand.
Um den Platz zu aktivieren und neue Nutzer*innengruppen anzuziehen fandenunterschiedliche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen statt, wie Workshops, gemeinschaftliches Kochen, Bau eines temporären Pavillons, Begrünung des Platzes, Konzerte und Performances, Nachbarschaftsradio, spezielle Angebote für Kinder und Teenager, etc. Alle Veranstaltungen waren kostenlos und richteten sich an alle Menschen – nicht nur ein Mittel- und Oberschichtspublikum wurden angezogen.
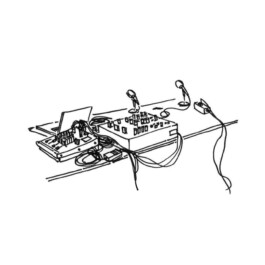
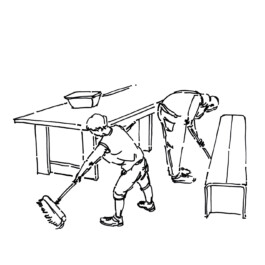
Der Nachbarschaftsradiosender “Radio Moskou” wurde von Toestand und zwei lokalen Radiostationen ins Leben gerufen. Es entstand eine kleine Radio-Community, die bis heute aktiv ist.
Durch die limitierten Ressourcen war der Prozess von „Caring and Maintaining“ – auch wenn dieser oft unsichtbar bleibt – von Anfang an ein wichtiges Ziel des Projekts. Alles geschah in engem Austausch mit den Menschen vor Ort. Diese wurden nicht nur zum Mitmachen mobilisiert, sondern entwickelten ein Verantwortungsgefühl für das Mobiliar am Platz.
Interview

Bernardo Robles Hidalgo (Architekt und Bauprojektleiter) im Gespräch mit Christina Schraml (Social Design Studio) am 18.02.2020
“Während des gesamten Projekts war die Frage des Scheiterns für mich eine sehr wichtige. Wenn ich mit Leuten über unsere Interventionen redete, bekam ich häufig folgende Reaktion: „Das wird nicht funktionieren, weil die Nutzer*innen vor Ort – vorwiegend Alkohol- und Drogenabhängige – schwierige Menschen sind. Sie werden alles zerstören.“ Wir hatten zum Beispiel die Idee, verschiedene Topfpflanzen am Platz zu verteilen – in einer Größenordnung, die viel fragiler ist, als man sie normalerweise in der Stadt findet. Wir platzierten ganz viele und bekamen sofort die Rückmeldung, dass die Leute sie kaputt machen oder stehlen werden. Und das stimmte auch. Manche verschwanden oder wurden zerstört. Unsere Strategie war es deshalb, tagtäglich zum Platz zu gehen und die Töpfe einfach umzustellen und neue Pflanzen aufzustellen – so, dass eigentlich nie jemand merkte, dass Töpfe verschwunden waren. Und irgendwann blieben die Töpfe – es sättigte sich der Bedarf beziehungsweise die Leute hörten auf, Töpfe mit nachhause zu nehmen. Es ist eine Frage der Zerbrechlichkeit der Stadt, in der normalerweise alles sehr statisch ist. Und ich frage mich, welche Art von Gesellschaft wir schaffen, wenn wir als Bürger*innen immer nur mit Objekten konfrontiert werden, mit denen wir eigentlich gar nicht interagieren können. Die Nachbar*innen nahmen an unseren Aktivitäten teil und wir unterstützten sie, eigene Dinge zu initiieren. Manchmal ging etwas schief, aber es war trotzdem gut. Scheitern ist keine große Sache, wenn man etwas daraus lernen kann. “ (Bernardo Robles Hidalgo, 18.02.2020)
“Ich reagiere ein bisschen allergisch, wenn ich Partizipation nur höre. Die Gemeinde führt Beteiligungsprozesse immer nach dem gleichen Schema durch: Sie stellen einen Tisch auf und teilen Flugblätter aus. Sie bitten Passant*innen, den Platz aufzuzeichnen, so wie sie ihn sich vorstellen. Dann beauftragen sie ein Architekturbüro, die Skizze der Nutzer*innen eins zu eins umzusetzen. Sie sagen, die Nutzer*innen wollen es so und der Architekt kann dann eigentlich nicht widersprechen. Sie verstehen nicht, das die Fähigkeit von Expert*innen darin besteht, über das hinaus zu lesen, was die Nutzer*innen glauben, was sie möchten und brauchen. Wenn man mit Knieschmerzen zum Arzt geht, sagt man dem Arzt auch nicht, dass er das Bein amputieren muss. Man erklärt dem Arzt, wo es weh tut. Der Arzt wird das Bein genau untersuchen, vielleicht ein Röntgenbild machen oder andere Fachexpert*innen hinzuziehen, um zu verstehen, warum das Knie schmerzt. Und manchmal muss man vielleicht einfach nur andere Schuhe tragen, um die Schmerzen zu behandeln. Darum war ich so oft wie möglich vor Ort, um kontinuierlich im Austausch mit den Menschen zu sein und sie dabei zu beobachten, wie sie mit dem Platz interagieren. Auf diese Weise versuchte ich die verschiedenen Aspekte zu verstehen, warum das Knie schmerzt, beziehungsweise der Platz nicht gut funktioniert. Partizipation ist für mich ein Medium, durch das sich Menschen näherkommen und sich über etwas austauschen können.“ (Bernardo Robles Hidalgo, 18.02.2020)
„Sogenannte „unerwünschte“ Gruppen werden immer im öffentlichen Raum sein. Gerade eine prekäre Gruppe, wie Alkoholabhängige, sind die widerstandsfähigste, die man in einer Stadt finden kann. Wenn die Stadtverwaltung mit ihren konventionellen Interventionen, wie etwa dem Entfernen von Sitzbänken versucht, diese Nutzer*innen vom Platz fernzuhalten, wird ihr das nicht gelingen. Diese Gruppen gehen nicht weg, sondern setzen sich dann halt auf den Boden. Wer mit solchen Maßnahmen aber verdrängt wird, sind z.B. die Mütter mit ihren Kindern. Sie gehen dann am Platz vorbei, weil sie nicht neben solchen „Randgruppen“ sitzen möchten. Es gibt einfach wenig Berührungspunkte zwischen diesen unterschiedlichen Nutzer*innengruppen. Viele haben Vorurteile gegen Alkoholisierte. Obwohl viele Nachbar*innen schon Jahre lang nebenan wohnten, kam es für sie gar nicht infrage, sich auf den Platz zu setzen. Erst als wir mobile Stühle am Platz verteilen, begannen sie den Raum wahr- und allmählich einzunehmen. Sobald eine Vielfalt an unterschiedlichen Menschen auf einem Platz Zeit verbringt, scheint es viel natürlicher, neben „unerwünschten“ Gruppen Platz zu nehmen. Die Menschen verstehen dann allmählich, dass sie nicht so gefährlich sind, wie oft projiziert wird. Und genau diese sonst so „unerwünschten“ Menschen waren diejenigen, die uns bei unseren Aktivitäten vor Ort aktiv unterstützten. Sie kümmerten sich um unsere Topfpflanzen und begrüßten uns freundlich am Morgen. Sie wurden zu einem wichtigen Partner im gesamten Projekt.“ (Bernardo Robles Hidalgo, 18.02.2020)
„Eines der Schlüsselelemente im Projekt – und was es für mich einzigartig gemacht hat – ist, dass bei Marie Moskou von Anfang an formal festgelegt war, dass unsere Interventionen trotz zeitlicher Begrenztheit, nachhaltige Auswirkungen haben werden. In unseren Zwischennutzungsprojekten von Gebäuden war das bisher nicht wirklich der Fall. Künstler*innen und Kreative nutzen Räume temporär und setzen damit ein Licht in einem Stadtteil. Aber in der Regel bedeutet es nur ganz selten, dass sie im endgültigen Projekt auch einen Raum bekommen und ihre Arbeit vor Ort weiterführen können. Wir spüren diese Lücke sehr stark, dass es in diesen Übergangsprojekten wenig Möglichkeiten gibt, auch auf das endgültige Projekt einzuwirken. Ob die geplante Umgestaltung des Platzes erfolgreich sein wird oder nicht, hängt davon ab, ob es den Architekt*innen gelingen wird, den sozialen Aspekt, den wir auf diesem Platz geschaffen haben, in die Zukunft zu übertragen. Meine Absicht war es von Anfang an, die Menschen zu sehen. Es geht nicht primär darum, die Realität anzupassen, sondern die Kultur, die man hinter einem Ort konstruiert, zu verändern. Es geht nicht darum den Raum komplett umzugestalten, sondern darum, die Elemente, die für den Raum „giftig“ sind, durch andere auszutauschen, die den Nutzer*innen das Gefühl vermitteln, dass der Platz ihnen gehört, aber genauso gut allen anderen. Für mich bedarf es dafür keiner kompletten Umgestaltung.“ (Bernardo Robles Hidalgo, 18.02.2020)
