STADTLÜCKEN
Der Österreichische Platz – ein "Unort" als Freiraum
Beitrag von Akina Hocke

Ob Pflanzentausch, Kopfhörerkonzert, Kinoabend oder gemeinsames Schlemmen: zwei Jahre lang fanden die unterschiedlichsten Veranstaltungen unter der Paulinenbrücke statt. © Stadtlücken e.V.
Verortung
Österreichischer Platz/ Paulinenbrücke, Stuttgart, Deutschland
Zeitraum
2016; 2018-2019
Größe
ca. 450m2
Akteur*innen
Stadtlücken e.V., Stadt Stuttgart
Besitzverhältnisse
Eigentum der Stadt Stuttgart; 2018-2019: Verwaltung durch Stadtlücken e.V.; seit 2019: Verwaltung als öffentlicher Raum vom Amt für Sport & Bewegung
Rechtliche Rahmenbedingungen
Bottom-up Stadterneuerungsprozess; 17-monatiger Pachtvertrag an Stadtlücken e.V.
Finanzierung
Hauptsächlich ehrenamtlich; privat durch den Verein und über Spenden; Materialkosten unterstützt durch Forschungsprojekt WhatSUB(2016), Bürgerstiftung Stuttgart (2016), Stadt Stuttgart (2018-2019); Bezirk Stuttgart Süd (2018-2019)
Links
www.stadtluecken.de
instagram.com/stadtluecken
instagram.com/oesterreichischer_platz
Abstract
Welchen Rolle spielen Ambivalenz und Unbestimmtheit im Stadtbild? Die Stadt Stuttgart wurde in den 60er Jahren stark auf die dort ansässige Automobilindustrie ausgerichtet: breite Straßen und Verkehrsknoten prägen seither das Stadtbild und strukturieren das Leben im öffentlichen Raum. Der Österreichische Platz ist ein Paradebeispiel für diese Entwicklung. Der größte überdachte Platz Stuttgarts liegt an einem Verkehrsrondell in der Innenstadt. Eine sechsspurige Verkehrsstraße trennt die Innenstadt von den umliegenden Vierteln und definiert das Auto als Haupttransportmittel. Zu Fuß kann der Österreichische Platz nur über gigantische Kreuzungen mit wenigen Übergängen oder über versteckte Unterführungen erreicht werden. Die Straße dient Fußgänger*innen schon lange nicht mehr als Ort zum Verweilen, Schlendern oder Zusammenkommen. Die angrenzenden Plätze wirken leer und fremd.
Dass solche Unorte jedoch auch Potenzial bieten können, zeigt der ehrenamtliche Verein Stadtlücken e.V. Er beschäftigt sich seit 2016 mit Lücken im Stadtbild, seien es “Bau-, Wissens-, Rechts-, Kommunikations- [oder] soziale Lücken”. Terrain vagues (Morales, 1996), also undefinierte und vergessene Lücken in der Stadt, sind ambivalente Orte. Sie entziehen sich einem klaren Nutzen, können jedoch gerade dadurch Potenzial und Handlungsspielraum schaffen und bieten einen Gegenentwurf zur durchdefinierten und funktionalen Stadtplanung. Die Unbestimmtheit dieser Orte schafft Grundlage für eine Vielfalt von Nutzungen und erlaubt so mehr Inklusion im urbanen Raum. Ob der Österreichische Platz Unort oder Freiraum ist, ist laut Stadtlücken e.V. eine Frage der aktiven Interpretation. Von 2016 bis 2019 verwandelte das interdisziplinäre Team aus Gestalter*innen, Stadtplaner*innen, Architekt*innen und engagierten Bürger*innen den Österreichischen Platz, genauer gesagt den anliegenden Platz unter der Paulinenbrücke, in einen Ort des Zusammenkommens, Spielens und Experimentierens. Stadtlücken bewegen sich dabei stets im Spannungsfeld zwischen kreativer Aneignung durch Bürger*innen und behördlichen Auflagen. Das Projekt zeigt die transformative Kraft der Aneignung urbaner Lücken auf: Auch wenn das temporäre Aktivierungsprojekt heute nicht mehr unter der Paulinenbrücke existiert, bleibt die Vision einer inklusiven, kreativen und sozialen Stadt bestehen.



Die Interventionen am Österreichischen Platz setzten auf nachhaltige, lokale Materialien wie recyceltes Holz, Bauteile des Ortes und umgenutzte Elemente. © Stadtlücken e.V.
Aus einem Parkplatz wird ein lebendiger Treffpunkt. © Stadtlücken e.V.
Neue Visionen für den Österreichischen Platz: ein grüner, kooperativer Stadtraum inklusive einer Freitreppe, die die Stadtteile wieder miteinander verbindet. © Stadtlücken e.V.
Charakteristika


Der Prozess begann im Oktober 2016 mit einer zweiwöchigen Aktion, bei der ein Souvenirkiosk, eine Veranstaltungsreihe und ein digital-analoges Abstimmungstool eingesetzt wurden. Die gesammelten Ideen wurden direkt ins Rathaus getragen und vor dem Büro des Baubürgermeisters ausgestellt. Aufgrund des großen Zuspruchs in der Bevölkerung und Politik beschloss der Gemeinderat 2017, den Pachtvertrag mit der Parkplatzfirma zu kündigen und den Platz dem Verein für zwei Jahre als Experimentierfeld zur Verfügung zu stellen.
Die Partizipation folgte dem Motto „Aktivierung statt Beteiligung". Es wurden verschiedene Formate wie „Runde Tische„, Nachbarschaftstreffs, Diskussionsrunden und ein Ideenformular angeboten. Due Kommunikation wurde zusätzlich über digitale Kanäle wie Blog, Website, Social Media und das Beteiligungsportal der Stadt Stuttgart geführt. Wichtig war Stadtlücken e.V. eine Präsenz vor Ort, z.B. in Form von Bauwerkstätten, um schnell mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ein besonderes Format war das „Fairytale Dinner", bei dem verschiedene Akteur*innen an einem als 1:25-Modell des Platzes gestalteten Esstisch zusammenkamen und gemeinsam das Märchen vom Österreichischen Platz schrieben.


Im Rahmen des Projekts transformierte sich der Österreichische Platz von einem "Unort" zu einem lebendigen Treffpunkt, der von gegenseitigem Respekt und Miteinander geprägt ist. Dies zeigt sich besonders in Initiativen wie dem „PauleClub", einer Selbstorganisation von Substituierten und ehemaligen Obdachlosen, sowie „Harrys Bude", einem Foodsharing-Projekt eines ehemaligen Obdachlosen, das heute von über 40 Ehrenamtlichen unterstützt wird. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass alle Menschen – unabhängig von ihrer Lebenssituation – Teil der Stadtgemeinschaft sind und sein können.
Über 150 verschiedene Events und kooperative Nutzungen fanden unter der Paulinenbrücke statt: von Kinoabend, Tischtennisturnier, Kaffeekränzchen bis Kopfhörerkonzert. Voraussetzung für die Konzepte war dabei stets, dass die Nutzung flexibel und konsum- und kostenfrei bleibt.

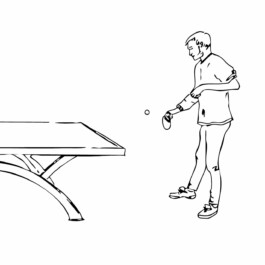
Die Materialwahl für die Interventionen am Österreichischen Platz folgte einem nachhaltigen und lokalen Ansatz. Es wurde vorwiegend mit recycelten Materialien gearbeitet: Ein umgenutztes Weihnachtsmarkthäuschen bildete eine wichtige Basis, ergänzt durch übrig gebliebene Elemente von Theater- und Veranstaltungsproduktionen. Besonders kreativ war die Integration von vorhandenen Bauteilen des Ortes selbst, wie beispielsweise einer alten Leitplanke. Diese wurde durch Holz als Hauptbaustoff ergänzt. Zusätzlich benötigte Materialien, Schrauben und Werkzeuge wurden aus pragmatischen Gründen von einem nahegelegenen Baumarkt bezogen. Dieser Mix aus Recycling, Upcycling und neuen Materialien zeigt einen ressourcenschonenden und gleichzeitig praktischen Ansatz zur Gestaltung des öffentlichen Raums.
Nach der erfolgreichen Experimentierphase beschloss der Gemeinderat, den Pachtvertrag mit der Parkplatzfirma dauerhaft zu kündigen. Aktuell wird der Platz vom Amt für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart als "Öschi" betrieben. Eine Stelle des Quartiersmanagers war 2021-2023 aktiv, welche jedoch nun verwaltungsintern abgedeckt werden soll.
Interview
Akina Hocke (Social Design Studio) im Gespräch mit dem Verein Stadtlücken, Jänner 2025.
Welches Potenzial bieten Stadtlücken beziehungsweise terrain vagues?
Das Konzept der Stadtlücken geht weit über physische Leerstellen im urbanen Raum hinaus. „Lücken" können sich als Bau-, Wissens-, Rechts-, Kommunikations- und soziale Lücken manifestieren. Am Beispiel des Österreichischen Platzes wird deutlich, wie selbst ein vermeintlicher „Nicht-Ort" – ein Parkplatz unter einer Autobrücke – erhebliches Potenzial für neue Nutzungen und soziale Interaktionen bietet. Die kontinuierliche Entwicklung der Stadt führt dabei stetig zu obsolet werdenden Gebäuden und Infrastrukturen, die neue Möglichkeitsräume eröffnen. Durch kreative Methoden und kooperative Stadtgestaltung können diese Lücken sichtbar gemacht und für gemeinwohlorientierte Projekte genutzt werden, wobei bestehende Strukturen nicht nur erhalten, sondern auch zeitgemäß interpretiert werden.
Wie seid ihr auf den Österreichischen Platz aufmerksam geworden?
Wir haben zuerst Lücken im Stadtgebiet kartiert und bei unserem Format „Einmal im Monat” diskutiert, an welchem Ort wir als erstes aktiv werden wollen. Weitere Lücken waren damals der Marktplatz in Stuttgart, zeitlich leerstehende Shopping-Malls, die Ruine Villa Moser, der Nesenbach, der Feuersee oder auch das Neckarufer. Der Österreichische Platz war als zentraler Verkehrsknotenpunkt in Stuttgart bereits bekannt. Der Raum war seit den 1960er Jahren von breiten Verkehrsschneisen geprägt und wurde in den letzten 30 Jahren von der Stadt Stuttgart an eine Parkplatzfirma verpachtet. Der prekäre Raum unter der Paulinenbrücke ist kein Platz im herkömmlichen städtebaulichen Sinne, daher haben wir erstmal die Frage gestellt: Wo ist der Österreichische Platz?
Wie wurde der Platz verwaltet bzw. gepflegt?
Die Verwaltung und Pflege des Österreichischen Platzes wurde während der Experimentierphase von 2018 bis 2019 durch den Verein Stadtlücken e.V. als kuratorische Instanz betreut. Der Verein nahm dabei eine wichtige Vermittlerrolle zwischen verschiedenen städtischen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ein. Ein zentrales Element dieser Verwaltungsstruktur war der im Rathaus etablierte Runde Tisch, der als Plattform für den Austausch zwischen allen beteiligten städtischen Ämtern und Stadtlücken als zivilgesellschaftlicher Vertreterin diente. Hier wurden nicht nur Informationen geteilt, sondern auch aktiv Probleme diskutiert und neue Lösungsansätze entwickelt.
Die Koordination des Platzes erfolgte in einem komplexen Netzwerk aus verschiedenen Institutionen. Dabei arbeiteten das Stadtplanungsamt, das Tiefbauamt, das Amt für öffentliche Ordnung, die Wirtschaftsförderung und die Bezirksvorstände eng mit dem Verein Stadtlücken e.V. zusammen. Um die aktive Nutzung des Platzes zu ermöglichen, entwickelte der Verein ein Ideenformular, das sowohl analog vor Ort als auch digital verfügbar war. Über dieses System konnten sich interessierte Bürger*innen, Initiativen und Institutionen für die Durchführung von Aktionen auf dem Platz bewerben. Der Verein übernahm dabei die wichtige Aufgabe, zwischen den verschiedenen Interessent*innen zu vermitteln und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Platz seinen öffentlichen Charakter behielt.
Heute hat sich die Verwaltungsstruktur gewandelt: Der Platz wird nun unter dem Namen „Öschi" vom Amt für Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart betreut und erfährt einen etwas formelleren Charakter in der Verwaltung der Fläche.
Welche rechtlichen und finanziellen Hürden gab es?
Eine zentrale Herausforderung war der hohe ehrenamtliche Aufwand. Die ca. 30 Vereinsmitglieder mussten neben ihrem Beruf wöchentliche Projekttage und Vereinstreffen sowie zahlreiche Abstimmungstermine mit verschiedenen Ämtern und Akteur*innen koordinieren. Die zugesprochenen Gelder durften nur für Material ausgegeben werden und mussten aufwendig mit Einzelbelegen in Zuwendungsbescheiden nachgewiesen werden, für die Verwaltung und die Begleitung durch Berater*innen war jedoch kein Budget vorhanden. Bis heute fehlen Förderungen für Dokumentation und Evaluation des Projekts. Auf der rechtlichen Seite betraten wir Neuland, welches wir jedoch in Kooperation mit der Stadtverwaltung und vielen Beteiligten gemeinsam erörtern konnten.
Brauchen wir ein Amt für öffentlichen Raum?
Die Erfahrungen am Österreichischen Platz verdeutlichen die komplexen Verwaltungsstrukturen bei der Entwicklung öffentlicher Räume. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Amt für öffentliche Ordnung, Wirtschaftsförderung, Bezirksvorständen und dem Amt für Sport und Bewegung zeigt, dass bereits viele städtische Institutionen am öffentlichen Raum beteiligt sind. Die als innovativ und zukunftsweisend beschriebene interdisziplinäre und agile Kooperation zwischen den Ämtern und der Zivilgesellschaft deutet darauf hin, dass weniger ein neues Amt, sondern vielmehr effektive Koordinationsstrukturen und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten für erfolgreiche Stadtentwicklungsprojekte entscheidend sind. Ein zusätzliches Amt kann jedoch dieses Querschnittsreferat als ansprechbare Institution konkreter steuern.
Viele Projekte im Bereich der Stadtgestaltung sind Interim-Projekte: Wie schafft man permanente Räume in der Stadt? Welchen Vorteil bieten temporäre Projekte?
Die Transformation des Österreichischen Platzes zeigt exemplarisch, wie temporäre Interventionen als Wegbereiter für dauerhafte Veränderungen im Stadtraum wirken können. Der Prozess entwickelte sich von einer zweiwöchigen Aktion (2016) über eine 17-monatige Experimentierphase (2018–2019) bis zur permanenten Umwidmung und aktueller Betreuung durch das Amt für Sport und Bewegung. Die temporären Projekte erwiesen sich dabei als wertvoll, da sie das Testen verschiedener Nutzungskonzepte ermöglichten, Akzeptanz in Bevölkerung und Politik schufen und Raum für flexible Anpassungen boten. Der Erfolg dieser schrittweisen Entwicklung basierte wesentlich auf der engen Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung sowie der von Anfang an klaren Zielsetzung des Vereins Stadtlücken, nicht als dauerhafter Betreiber zu fungieren, sondern eine langfristige städtische Lösung zu entwickeln.
Welche Tipps und Learnings habt ihr für andere Stadtaufmöbler*innen?
Die Erfahrungen des Vereins Stadtlücken e.V. am Österreichischen Platz zeigen einige zentrale Erfolgsfaktoren für urbane Transformationsprozesse. Der Ansatz „Aktivierung statt Beteiligung" hat sich als grundlegende Strategie bewährt. Besonders wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass solche Prozesse deutlich mehr Zeit benötigen als zunächst angenommen. In der Kommunikation sollte eine einfache, respektvolle Alltagssprache verwendet und digitale mit analogen Formaten kombiniert werden. Regelmäßige Präsenz vor Ort und Zeit mit den Menschen im Quartier sind unerlässlich. Der Verzicht auf einen vordefinierten Masterplan zugunsten eines experimentellen, offenen Prozesses ermöglicht es, verschiedene Nutzungskonzepte zu erproben und niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ämtern und Akteur:innen ist dabei elementar. Praktisch sollten frühzeitig Finanzierungsmöglichkeiten für Personal und Dokumentation eingeplant sowie rechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen berücksichtigt werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, als Fragesteller:in statt als Antwortgeber:in aufzutreten und offen für verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu sein.
Weitere Quellen:
Morales, J. (1996). Terrain vague. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, 164-171.
